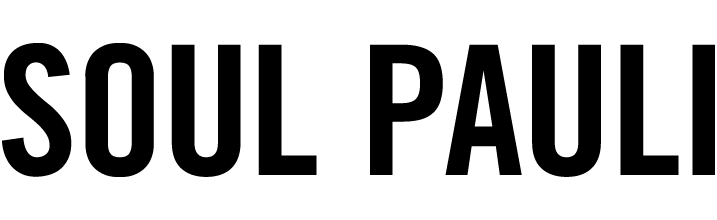St. Pauli ist bunt und vielfältig – die Menschen und durch sie die Geschäfte, Kneipen, Clubs, Bars, Wohnhäuser, …
Das Fotoprojekt „Soul Pauli“ von Christian Heidemann fokussiert sich auf die Gebäude und setzt sie in den Mittelpunkt, guckt jedoch mit mal kurzen, mal längeren Geschichten auch hinter die Fassaden.
Es geht neben aller Buntheit jedoch auch um Veränderungen. Vieles verschwindet, Neues entsteht; manchmal spannend, manchmal kommerzieller Einheitsbrei.
Daher will „Soul Pauli“ das Jetzt festhalten, aber auch einen Blick ins Früher werfen.
„Soul Pauli“ ist Work in Progress und wächst stetig weiter.
Hamburg, St. Pauli. Über den Stadtteil.
St. Pauli – bekannt als Vergnügungsviertel, um das sich zahlreiche Geschichten um Rotlicht, Kriminalität, Erotikshows, einer Straße namens Herbert, den Beatles, Nutella, und, und, und Fußball … ranken. St. Pauli ist jedoch viel mehr. Aber eins nach dem anderen.
Wer das heutige St. Pauli kennt, kann es schwer glauben aber die früheste Besiedlung war ein Zisterzienserinnen-Kloster, das im 13. Jahrhundert gegründet wurde und Ende des 13. Jahrhundert ins heutige Harvestehude verlegt wurde. Wohnansiedlungen waren zu der Zeit nicht gestattet, das störte jedoch einige Menschen nicht und allmählich wurde das Gebiet vor allem im südlichen Bereich besiedelt.
Anfang des 17. Jahrhunderts wurden zahlreiche Hügel des Vororts, der St. Pauli war, abgetragen, um Material für die Festungswälle Hamburgs zu gewinnen und um freies Schussfeld vor den Mauern am damaligen Millerntor zu haben. Aufgrund der früheren Hügellage entstand übrigens die Redewendung „auf St. Pauli“, die sich bis heute gehalten hat.
Wegen des freien Schussfelds waren Ansiedlungen weiterhin verboten, jedoch wurden ungewünschte Betriebe nach und nach auf die andere Seite von Hamburgs Stadtmauer verbannt. Vereinfacht gesagt: Alles was qualmte, stankt, laut war und Dreck machte, wie z.B. Tranbrennereien, war in der Stadt nicht gewünscht.
Das galt jedoch nicht nur für Betriebe, sondern auch für Institutionen wie den Pesthof. Neben den an epidemischen Krankheiten leidenden Kranken war der Pesthof auch ein Krankenhaus für psychisch kranke Menschen.
Da es in der Stadt immer enger wurde, zogen nach und nach Betriebe aus dem dicht besiedelten Stadtgebiet auf den Hamburger Berg – wie das spätere St. Pauli ursprünglich hieß.
Viele Handwerker, wie z.B. die Reepschläger und Seilermacher, gingen hier nun ihrem Handwerk nach und gaben den Straßen Reeperbahn und Seilerstraße ihre Namen. Religions- und Zunftfreiheit trugen dazu bei, dass immer mehr Menschen vor die Tore der Stadt umsiedelten – weswegen die Große Freiheit übrigens so heißt wie sie heißt.
Im 17. Jahrhundert entwickelten sich zudem Amüsierbetriebe im Viertel und zogen immer mehr Besucher aus der Stadt an, denn es galt als chic, sich zu amüsieren.
Nachdem 1814 unter französischer Besatzung das komplette Viertel abgerissen wurde – Napoleon wollte freies Schussfeld zwischen Stadtmauer und Elbe haben – war es einige Jahre später schon wieder aufgebaut. Amüsierbetriebe waren zahlreicher und größer denn je vertreten, Bordelle wurden wieder geöffnet und Tanzsäle und Theater entstanden. Zudem kamen mehr und mehr zahlungskräftige Matrosen ins Viertel. Dampfschiffe mussten mit ihren qualmenden Schloten außerhalb der Stadt an den Landungsbrücken anlegen und Seemänner kamen somit auf den Hamburger Berg, statteten den Liebesdamen Besuche ab und stillten ihren Durst in neu entstehenden Kneipen und Lokalen.
1833 wurde der Stadtteil dann in St. Pauli umbenannt – nach der gleichnamigen Kirche St. Pauli.
Ab 1840 wurde auf dem Spielbudenplatz, in Holzbuden und Zelten, Kleinkunst dargeboten. Eine Art Jahrmarkt mit Krambuden, Gaststätten und Tanzdielen, betrieben von reisenden Händlern und Schaustellern. Die Buden wichen später soliden Gebäuden für Theater, Zirkusse, Trinkhallen oder sonstigen Amüsierbetrieben – der Grundstein für die heutige lebendige Theaterszene St. Paulis.
Nach dem Ersten Weltkrieg brachen schwere Zeiten für die Amüsierbetriebe an und die klammen Portemonnaies der Menschen sorgten auch für klamme Kassen in Theatern, Konzerthäusern und Varietés.
Nur langsam erholten sich die Stadt und das Viertel vom Krieg.
Viele Bewohner St. Paulis waren (und sind heute noch) politisch links eingestellt. Um 1933 galt St. Pauli als Hochburg der KPD und war somit ein Dorn im Auge der Nationalsozialisten.
Rund um die Schmuckstraße entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts das Hamburger Chinesenviertel, wo 1944 etwa 130 chinesische Männer, sowie einige mit ihnen befreundete oder zusammenlebende deutsche Frauen von der Hamburger Gestapo inhaftiert und misshandelt wurden. In Arbeitslagern kamen mindestens 17 von ihnen ums Leben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren große Teile des Viertels zerstört, jedoch fand das Vergnügungsviertel in den 1950er und 60er Jahren zu seiner Beliebtheit zurück.
Nicht ganz unbeteiligt daran waren die ersten Auftritte der Beatles im Indra. Rund um die Reeperbahn gab es Live-Musik-Clubs, wie das besagte Indra, den Star-Club, den Kaiserkeller, das TOP TEN, und, und, und, … mit Konzerten und spontanen Sessions an jedem Abend. Die Beatles traten zusammen mit Tony Sheridan vom 1. April bis zum 1. Juli 1961 sogar zweiundneunzig Nächte nacheinander auf – sieben Stunden pro Abend, am Wochenende acht Stunden.
Jimi Hendrix, The Searchers, Bill Haley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard, The Rattles, Cream, Ray Charles, Fats Domino, … sie alle spielten auf St. Pauli.
Für viele junge Menschen waren die Musikclubs jedoch mehr: Sie waren Orte der Rebellion gegen gesellschaftliche Zwänge und Orte der Freiheit. Der Fotograf Günter Zint sagte: „Den Star-Club haben wir geliebt, weil unsere Eltern ihn gehasst haben.“ Dewegen hatte auch die Obrigkeit die Clubs auf dem Kieker und machte ihnen das Leben schwer.
Heute sind es Musikclubs wie Docks, Große Freiheit 36, Gruenspan, Indra, kukuun, Kaiserkeller, Mojo, Molotow und viele mehr, die für musikalische Vielfalt auf St. Pauli sorgen.
Zudem entwickelte sich die lebhafte Theaterszene rund um den Spielbudenplatz und die Reeperbahn weiter, die bis heute das kulturelle Angebot auf St. Pauli bereichert.
In den 60er Jahren fing das Rotlichtgewerbe an zu boomen. Die große Zeit der Huren, Luden, Tabledance Bars und Live Sex-Shows brach an.
René Durand eröffnete das Salambo, ein Live-Sex-Kabarett. In künstlerisch inszenierten Stücken wurde Sex auf der Bühne praktiziert. Auch im Safari wurde es bunt getrieben. In Stücken wie „Tanz der Vampire“ oder „Biene Maja“ wurden die sexuellen Höhepunkte der DarstellerInnen verpackt.
Zudem öffneten nach und nach immer mehr Bordelle, Table-Dance-Bars, Sex-Kinos und Sex-Shops ihre Türen rund um die Reeperbahn und ihre Seitenstraßen. Koberer standen vor der Tür und lockten (und locken noch immer) mit deftigen Sprüchen à la „Na nu ma nicht so schüchtern, Ihr kleinen Wichsmäuse. Rein mit Euch zur Samenabzapfung!“ Kundschaft in die Bars. Natürlich nicht zu vergessen: Die Herbertstraße mit ihren Prostituierten, die, in Fenstern sitzend, Freier locken. Eine Straße, sichtgeschützt und nur zugänglich für Männer – ein Überbleibsel aus dem Nationalsozialismus aus der Zeit um 1933, zu der Prostitution verboten war, auf St. Pauli jedoch in dieser einen Straße gedultet wurde.
Das Geschäft wurde härter und erste Ludenbanden gründeten sich.
Die „GMBH“ (zusammengesetzt aus den Initialen der Gründungsmitglieder) kontrollierte große Teile der Prostitution auf St. Pauli, später kamen weitere Banden wie z.B. die „Nutella-Bande“ hinzu. Junge wilde Kerle, die anfangs von den älteren Luden belächelt wurden und daher den Spitznamen Nutella-Bande bekamen, da sie wie Milchbubis aussahen, die sich morgens Nutella auf die Butterbrote schmieren.
Lange Zeit galt das ungeschriebene Gesetz, Probleme untereinander und ohne Waffen zu lösen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn Argumente nicht mehr ausreichten, wurde mit den Fäusten gesprochen – das Faustrecht.
Ein kleiner Themenschlenker …
Als noch primär deutschsprachige Luden das Sagen auf dem Kiez hatten, entwickelte sich das sog. Nachtjargon – eine Art Geheimsprache, mit der sich Luden, Prostituierte, Türsteher und Barbesitzer unterhalten konnten, ohne dass Dritte einen blassen Schimmer hatten, worum es eigentlich ging. Oder wusstest Du, dass die „Hamburger Acht“ Handschellen, der „Hund“ Pistole, ein „dänischer Kuss“ Kopfnuss bedeutet und dass ein „Dibberkasten“ ein Telefon ist?
Durch die Internationalisierung des Milieus – dass sich auf St. Pauli richtig viel Geld verdienen ließ, sprach sich nach und nach rum und zog auch Banden aus dem Ausland an – verlor diese Geheimsprache jedoch immer mehr an Bedeutung und heute sprechen nur noch ein paar alte Kiezianer diesen Jargon.
Mit der Verbreitung der „weißen Welle“ Kokain – vorher gab es noch „Cappis“, ein Aufputschmittel, das kurze Lunten noch kürzer machte und nicht wirklich zur Entspannung im Milieu beitrug – den zunehmenden Bandenkriegen um die Vorherrschaft auf dem Kiez und dem Aufkommen von Aids ging es mit den Geschäften rasant bergab. Auch wenn St. Pauli als Rotlichtviertel medial noch immer sehr präsent ist. Die Bandenkriege zwischen den Luden, die Auftragsmorde durch „Mucki“ Werner Pinzner, Nepp durch Gastronomie und Prostituierte, der Mörder Fritz Honka, … sorgen noch heute immer wieder für Presse und liefern Futter für viele Geschichten, Filme und Bücher – oder Fotoprojekte.
Live-Sex-Kabaretts wie das Safari schlossen ihre Türen und nach und nach verschwinden alte Sex-Shops und Sex-Kinos. Einige Läden halten sich jedoch noch heute. Entweder weil sie mit der Zeit gegangen sind, oder weil die vorwiegend männlichen Besucher das teilweise ranzige und schmuddelige Ambiente der alten Läden besonders reizvoll finden.
Mit dem Rotlichtmilieu von damals hat das St. Pauli von heute jedoch nicht mehr viel zu tun. Es ist vielmehr der Mythos von früher, der heute die Touristen in Scharen in das Viertel lockt.
Das Geschäft ist sauberer geworden und heute fahren die schweren Jungs von früher eher Smart, als dicke Karren. Parkplätze werden halt auch nicht mehr und größer.
Die 80er Jahre waren die Zeit der Gangs, ob auf St. Pauli oder in anderen Stadtteilen. Sie hießen Breakers, Streetboys, Champs, Mods, Sparks, …
Mit Rasierklingen unter den Armen zogen sie durch ihr Viertel, das es zu verteidigen galt. Gegen den vermeintlichen Feind – den sie teilweise gar nicht so genau kannten.
Wer waren die Jungs? Woher kamen sie? Über einen Kamm scheren ließen sie sich nicht. Gerne wurden sie als „milieugeschädigt“ bezeichnet. Jedoch gab es hinter jedem Gangmitglied eine individuelle Geschichte.
Auf die Frage nach dem „Warum“ schreibt Michel Ruge in seinem Buch „Der Bordsteinkönig“: „Die Achtundsechzig mutierte zu einer moralischen Diktatur der Gutmenschen. Dabei vergaß man, uns Jungen einen kreativen Freiraum zu lassen, in dem wir uns ausprobieren konnten. Wie alle Jugendlichen sehnten auch wir uns danach. Etwas in uns ließ uns keine andere Wahl. Wir wollten kämpfen, lieben und unsere Schlachten schlagen, ohne dabei bevormundet zu werden. Wir wollten unseren eigenen Weg entdecken. Und es musste einer sein, auf dem nicht schon unseren Eltern gegangen waren.“
Oder die Gang war ganz einfach die Ersatzfamilie. Oder, oder, oder. Inspirierend für sie war auf jeden Fall der US-Kinofilm „The Warriors“.
Es wurde sich geschlagen, es wurde geklaut und die Spirale der Kriminalität fing an, sich immer weiter und schneller zu drehen. Wie ein Karussell, aus dem es irgendwann nicht mehr so leicht war auszusteigen. Für einige Gangmitglieder war es der Einstieg ins Milieu, für andere ins Gefängnis. Wiederum andere Mitglieder stiegen nach und nach aus oder fielen Drogen zum Opfer.
2017 gab es ein Treffen der früheren Gangmitglieder, initiiert von Michel Ruge. „Gangs United“. Früher undenkbar, heute möglich. Sogar ohne fliegende Fäuste, Messer, …
In den 80er Jahren waren es vor allem die Hausbesetzungen in der Hafenstraße, die den Ruf des widerständischen St. Pauli begründeten.
24 Stunden, länger sollte kein Haus in Hamburg besetzt sein. Das war die knallharte Regel des Innensenators Alfons Pawelczyk, um eine Besetzungswelle wie im damaligen West-Berlin 1981 zu vermeiden.
Das wussten jedoch auch die Bewohner/innen der zwölf Häuser aus der Gründerzeit in der Hafen- und Bernhard-Nocht-Straße und besetzten sie ab Herbst 1981 schleichend. Nicht auf einen Schlag, sondern Wohnung für Wohnung. Ganz leise und ohne großes Tamtam.
Hinzu kamen Studenten und Autonome. Kurzum – Menschen, die eine Bleibe suchten.
Der Besitzer, das kommunale Wohnungsunternehmen SAGA (Siedlungs-Aktiengesellschaft Altona), sah das natürlich nicht gerne, denn eigentlich sollten die Häuser abgerissen werden und Platz für Neubauten mit bis zu 22 Geschossen machen. Denn wer die Ecke kennt – es ist schon ein unglaubliches Filetgrundstück direkt an der Elbe.
Es entstand ein jahrelanges Tauziehen, bei dem die Besetzer/innen die Selbstverwaltung der Gebäude forderten. Über 30 Mal sollen die Häuser gestürmt und wieder „instandbesetzt“ worden sein. Dieses juristische Tauziehen spielte den BesetzerInnen jedoch in die Karten, denn in der Zwischenzeit renovierten sie die Häuser und entkräfteten die Argumente der Unbewohnbarkeit. 1983 erhielten sie einen befristeten Nutzungsvertrag, die Spannungen hielten jedoch an und mündeten in teilweise gewalttätigen Ausschreitungen.
1986 eskalierte die Lage. 12.000 Menschen zogen durch Hamburg und solidarisierten sich mit der Hafenstraße und es kam zu schweren Ausschreitungen mit vielen Verletzten.
Nachdem es auch 1987 nicht zu einer Einigung kam und mit der Räumung gedroht wurde, bereiteten sich die Bewohner der Hafenstraße auf einen Straßenkampf vor, bauten Stahltüren ein, verbarrikadierten Fenster, sicherten die Dächer mit Stacheldraht, bauten meterhohe Barrikaden auf und der Piratensender „Radio Hafenstraße“ ging als Sprachrohr für die Hafenstraße auf Sendung – die Zeit der Barrikadentage brach an.
Die Hafenstraße war wochenlang gesperrt und eine friedliche Lösung schien nicht mehr möglich, als Hamburgs Erster Bürgermeister Klaus von Dohnanyi einen ungewöhnlichen Weg wählte: Er verpfändete sein Amt und gab sein politisches Ehrenwort für eine vertragliche Lösung zu sorgen, wenn die Straßensperren abgebaut werden.
Die Barrikaden fielen und die Räumung wurde abgewendet. Ende 1987 unterschrieben Stadt und Bewohner einen Pachtvertrag zur Nutzung der Häuser. Unterschrieben wurde mit „B. Setzer“.
Es gab weiterhin Reibereien, aber die großen Konflikte waren beigelegt und 1995 verkaufte die Stadt die Häuser an die, eigens von einem Teil der BewohnerInnen dafür gegründete Genossenschaft, „Alternativen am Elbufer“. Sie vermietet die Häuser an den „Waterkant e.V.“.
Ohne die Besetzung 1981 wäre von diesem alternativen Quartier nichts mehr übrig.
„Widerstand lohnt sich“, sagt Claus Petersen. Er wohnt seit 1976 in der Hafenstraße.
Und heute? Heute stellt er fest, dass gefühlt mehr Polizei um die Häuser der Hafenstraße „herumlungert“ als zur Zeit der Besetzung.
Jedoch ist sie nicht mehr auf der Jagd nach HausbesetzerInnen. Seit 2016 haben sie vermeintliche Dealer im Visier und jagen sie die Balduintreppe hoch und runter.
Polizeihubschrauber kreisen jedoch nur noch selten über diesen Teil des Viertels. Und wenn, dann meistens eher wegen einem der vielen Großevents auf St. Pauli.
St. Pauli. Heute.
Ein ganz besonderes Fleckchen Erde. Ein Nebeneinander von Lebensentwürfen und Kulturen.
Aber auch mit ein paar Problem-Nüssen, die es sich lohnt zu knacken.
Noch 1990 galt St. Pauli als eines der ärmsten Stadtviertel Europas, was sich jedoch stark verändert hat. Wie in jeder Stadt sind arme Stadtteile mit niedrigen Mieten besonders attraktiv für junge Menschen, Studenten und kreativ-künstlerisch arbeitende Menschen. Gerade das führt zu einer bunten Durchmischung und Lebendigkeit. Nach und nach jedoch auch zu einer gewissen Hippness und somit Verdrängung, da Mieten stark steigen und Bevölkerungsstrukturen verschoben werden.
Ehrlich gesagt, nicht anders als in jeder anderen Großstadt auch. Der sozioökonomische Strukturwandel lässt grüßen. Wohlhabendere Bewohner sind per se kein Problem, schwierig wird es nur, wenn irgendwann keine gesunde Durchmischung mehr besteht – die Durchmischung, die das Viertel so besonders macht.
Jugendliche, die noch bei ihren Eltern wohnen, werden flügge, suchen die erste eigene Wohnung und können es sich höchstwahrscheinlich nicht leisten im Viertel zu bleiben – und müssen das gewohnte Umfeld und ihre sozialen Strukturen verlassen. Ältere Menschen können sich die Miete nach Sanierungen oftmals nicht mehr leisten und sind gezwungen den Stadtteil zu wechseln.
Klingt abgedroschen, aber auch deshalb, weil etwas dran ist: Alte Bäume verpflanzt man nicht. Simone Borgstede sagt dazu „Wohnungen, in denen Menschen lange leben, werden anfassbare Geschichte.“
Verpflanzt man Menschen, nimmt man ihnen nicht nur die vier Wände.
Aber nicht nur Bewohner leiden unter den steigenden Mieten, sondern auch Gewerbetreibende wie Bars, Kneipen, Etablissements … und Musikclubs. Letztere fürchten darum, ihr Programm ausschließlich massenkompatibel gestalten zu müssen, um die Mietkosten tragen zu können.
Hinzu kommen immer mehr Touristen (und Feiernde von außerhalb), die St. Pauli jährlich besuchen. Alle Besucher können natürlich nicht über einen Kamm geschert und verteufelt werden, da St. Pauli schon immer von Tourismus gelebt hat und dessen Existenz in einem Amüsierviertel begründet ist. Und dass sich Menschen für ein Viertel interessieren in dem man lebt, ist irgendwie auch ein Kompliment an St. Pauli und seine Bewohnerinnen und Bewohner. Aber das Wie und die berühmte Dosis, die das Gift macht, machen hier den Unterschied, denn kotzende und hauseingangvollpinkelnde Besucher braucht kein Ort. Auch nicht St. Pauli, wo alles etwas freier und lockerer gehandhabt wird. Das gilt jedoch nicht für Magen- und Blaseninhalte.
Den schwarzen Peter nur den Touristen zuzuschieben wäre jedoch zu kurz gedacht, denn die Probleme sind in vielen Fällen hausgemacht. Wenn noch und noch ein Großevent genehmigt wird, noch und noch mehr Großgruppen von TouristenführerInnen lautsprecherverstärkt krakeelend durch das Viertel getrieben werden und noch und noch mehr Ballermann-Rumms-Bumms-Musik in den Läden gespielt wird, darf sich nicht beschwert werden, dass ein entsprechendes Publikum durch das Viertel planiert. Wie sagte Rocko Schamoni in der Doku „Empire St. Pauli – von Perlenketten und Platzverweisen“? „Hier wird abgemolken. Das ist die Hauptmelkzentrale von Hamburg.“
Auf St. Pauli und in direkter Nachbarschaft gibt es einige mal kleinere, mal größere Musikclubs. Alle sind sie wichtig für die Musikkultur in Hamburg und die Vielfalt aus den Boxen auf St. Pauli. Gerade die kleineren Clubs klagen jedoch über geringe Unterstützung seitens der Stadt Hamburg – die all zu gerne auf die lebendige Musikszene in der Hansestadt aufmerksam macht. Ohne die kleinen Clubs und ihrer Förderung von jungen Bands versiegt jedoch irgendwann der Nachwuchs – gerade der lokale Nachwuchs.
Und dann kam Corona …
Ganz St. Pauli lag seit März 2020 im Dornröschenschlaf. Clubs, Bars, viele Geschäfte mussten schließen und auch Liebe konnte nicht gekauft werden.
Und auch sonst fand das Leben um die Reeperbahn nur mit angezogener Handbremse statt.
Kolja Koch, er betreibt mehrere Erotik-Shops auf der Reeperbahn, sagt:
„Die Vielfalt auf St. Pauli ist wie ein gutes Essen mit vielen Zutaten, das sich über Jahrzehnte entwickelt hat. Lässt Du ein paar der Zutaten weg, schmeckt’s nicht mehr.“
Das galt vor allem zu Zeiten von Corona, in der nicht alle Gewerbe ihrem Geschäft nachgehen konnten, sich jedoch gegenseitig bedingen.
Mittlerweile ziehen wieder Menschen statt Tumbleweeds durch die Straße und der Kiez lebt auf – auch wenn uns Corona weiterhin begleitet. Mal mehr, mal weniger.
St. Pauli. Morgen?
Oft wird die Frage gestellt, ob St. Pauli überhaupt noch St. Pauli ist und nicht verloren geht.
Schon über die Frage an sich kann hervorragend gestritten werden, da sich St. Pauli ständig wandelt und in den letzten Jahrhunderten immer wieder neu erfunden hat. Wann ist St. Pauli also St. Pauli?
Joachim Harms, er arbeitete über 20 Jahre in der Boutique Bizarr, hat folgende Antwort auf diese Frage: „Egal was sich auf St. Pauli verändert hat, eines gilt hier immer noch: Jeder ist mit seinen Eigenarten willkommen.
Stecke dir eine Pfauenfeder in den Hintern und laufe über die Reeperbahn, die Menschen würden sagen: ‚Oh, das ist jetzt Mode? Muss ich mal ausprobieren.‘
Jeder kann hier nach seiner eigenen Fasson glücklich sein. Sollte das hier nicht mehr gehen – dann ist es mit St. Pauli vorbei.“
Vielen Dank.
Ohne Eure/n Unterstützung/Austausch/Meinungen wäre das Projekt nicht möglich gewesen.
Aaron Böhm
Almedina Weber
Andy Scholz
Biggi
Carolin Schultze
Christian Homann
Christina Kuber
Claus Petersen
Dörte Wichmann
Dominik Großefeld
Elena Ochoa Lamiño
Eva Decker
Fenja Möller
Frank Egel (†️)
Frank Tannhäuser
Günter Zint
Jan Kopp Fotolabor
Jens Meyer-Odewald
Joachim Harms
Jonny Kliesch
Jörn Nürnberg
Julia Staron
Kalle Schwensen
Ken Hövermann
Kerstin Rose
Kolja Koch
Lars Schütze
Maryam Komeyli
Michael Schröder
Michel Ruge
Nicky Wichmann
Nina Kampe
Rebelzer
Rosi und Richard (†️) Sheridan McGinnity
Sankt Pauli Museum
St. Pauli Archiv
Stephan Delius
Simone Borgstede
Susan Lawrence
Susanne Leonhard
Thorsten Eigner