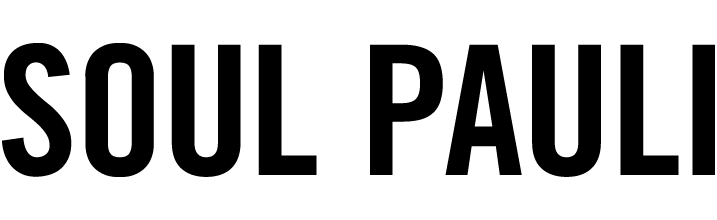6er Block
24 Stunden. Länger sollte kein Haus in Hamburg besetzt sein. Das war die knallharte Regel des Innensenators Alfons Pawelczyk, um 1981 eine Besetzungswelle wie im damaligen West-Berlin zu vermeiden.
Das wussten jedoch auch die Bewohner/innen der zwölf Häuser aus der Gründerzeit in der Hafen- und Bernhard-Nocht-Straße und besetzten sie ab Herbst 1981 schleichend. Nicht auf einen Schlag, sondern Wohnung für Wohnung. Ganz leise und ohne großes Tamtam.
Hinzu kamen Studenten und Autonome. Kurzum – Menschen, die eine Bleibe suchten.
Die SAGA (kommunales Hamburger Wohnungsunternehmen) sah das natürlich nicht gerne, denn eigentlich sollten die Häuser abgerissen werden und Platz für Neubauten mit bis zu 22 Geschossen machen. Denn wer die Ecke kennt – es ist schon ein unglaubliches Filetgrundstück direkt an der Elbe.
Es entstand ein jahrelanges Tauziehen, bei dem die Besetzer/innen die Selbstverwaltung der Gebäude forderten. Über 30 Mal sollen die Häuser gestürmt und wieder „instandbesetzt“ worden sein. Dieses juristische Tauziehen spielte den BesetzerInnen jedoch in die Karten, denn in der Zwischenzeit renovierten sie die Häuser und entkräfteten die Argumente der Unbewohnbarkeit. 1983 erhielten sie einen befristeten Nutzungsvertrag, die Spannungen hielten jedoch an und mündeten in teilweise gewalttätigen Ausschreitungen.
1986 eskalierte die Lage. 12.000 Menschen zogen durch Hamburg und solidarisierten sich mit der Hafenstraße und es kam zu schweren Ausschreitungen mit vielen Verletzten.
Nachdem es auch 1987 nicht zu einer Einigung kam und mit der Räumung gedroht wurde, bereiteten sich die Bewohner der Hafenstraße auf einen Straßenkampf vor, bauten Stahltüren ein, verbarrikadierten Fenster, sicherten die Dächer mit Stacheldraht, bauten meterhohe Barrikaden auf und der Piratensender „Radio Hafenstraße“ ging als Sprachrohr für die Hafenstraße auf Sendung – die Zeit der Barrikadentage brach an.
Die Hafenstraße war wochenlang gesperrt und eine friedliche Lösung schien nicht mehr möglich, als Hamburgs Erster Bürgermeister Klaus von Dohnanyi einen ungewöhnlichen Weg wählte: Er verpfändete sein Amt und gab sein politisches Ehrenwort, für eine vertragliche Lösung zu sorgen, wenn die Straßensperren abgebaut werden.
Die Barrikaden fielen und die Räumung wurde abgewendet. Ende 1987 unterschrieben Stadt und Bewohner einen Pachtvertrag zur Nutzung der Häuser. Unterschrieben wurde mit „B. Setzer“.
Es gab weiterhin Reibereien, aber die großen Konflikte waren beigelegt und 1995 verkaufte die Stadt die Häuser an die eigens von einem Teil der BewohnerInnen dafür gegründete Genossenschaft „Alternativen am Elbufer“. Sie vermietet die Häuser an den „Waterkant e.V.“.
Ohne die Besetzung 1981 wäre von diesem alternativen Quartier nichts mehr übrig.
„Widerstand lohnt sich“, sagt Claus Petersen. Er wohnt seit 1976 in der Hafenstraße.
Und heute? Heute stellt er fest, dass gefühlt mehr Polizei um die Häuser der Hafenstraße „herumlungert“ als zur Zeit der Besetzung.
Jedoch nicht mehr auf der Jagd nach HausbesetzerInnen: Seit 2016 haben sie vermeintliche Dealer im Visier und jagen sie die Balduintreppe hoch und runter.
Polizeihubschrauber kreisen jedoch nur noch selten über diesem Teil des Viertels. Und wenn, dann meistens eher wegen einem der vielen Großevents auf St. Pauli.
Günter Zint begleitete die Zeit der Besetzung fotografisch hautnah. In seinem Buch „Wilde Zeiten“ führt er die BetrachterInnen zurück in diese Zeit. Und nicht nur in die Hafenstraße, sondern auch zurück ins Hamburg der 1960er bis tief in die 1980er Jahre.
Wer lieber liest – die Geschichte der Hafenstraße ist so komplex (und dieser Text streift sie lediglich), damit wurden viele Bücher gefüllt, wie z.B. in „Hafenstrasse: Chronik und Analysen eines Konflikts“ von Niklaus Hablützel, Michael Herrmann, Hans–Joachim Lenger, Jan Philipp Reemtsma und Karl–Heinz Roth.